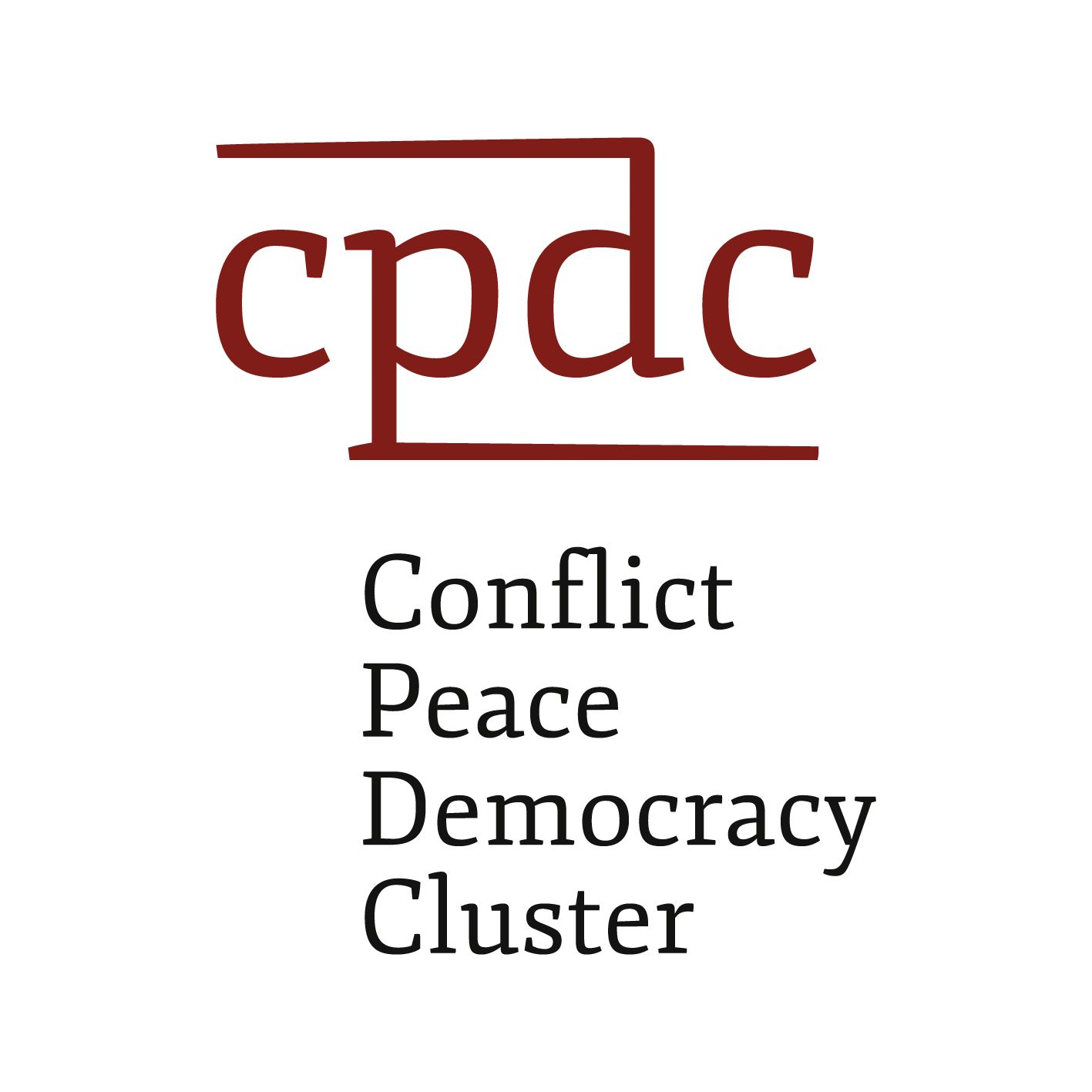Kritische Friedensforschung: Konzepte, Analysen & Diagnosen
Zum medialen/öffentlichen Echo des Buches
Das Sammelband “Kritische Friedensforschung” (2024) von Josef Mühlbauer & Maximilian Lakitsch wurde an der Universität Graz, Universität Marburg, im Österreichischen Journalist:innen Club, im Rahmen des Bücherfestivals Niederösterreichs, und u.a. am Kolloqium der AFK vorgestellt. Es liegt in weit über 30 (Universitäts-)Bibliotheken und wurde auch von Die Presse und Unsere Zeitung als Buch des Monats bzw. Buch am Sonntag vorgestellt.
Zum Kontext des Buches
Die militärische Invasion der Ukraine durch Russland zu Beginn des Jahres 2022 sowie die Covid-19-Pandemie haben gesellschaftliche und politische Dynamiken in Gang gebracht und zu zahlreichen Verwerfungen geführt. Gewissheiten wurden erschüttert, Grenzen und Zuordnungen verschoben. Vor diesem Hintergrund diskutiert dieser Band politische, soziale, und ökologische Prozesse und Phänomene aus der Sicht der kritischen Friedensforschung. Diese wirft einen Blick unter die Oberfläche des Offensichtlichen und beschreibt dahinterliegende Machtverhältnisse und unbewusste Aspekte.
Der Band versammelt Texte mit unterschiedlichen Schwerpunkten: wissenschaftliche Aufsätze, aber auch Essays, kürzere Abhandlungen sowie ein Interview zu einem breiten Themenspektrum: von militärischen Interventionen und religiösen Akteur:innen über den Zusammenhang von Klimakrise und Krieg bis hin zur Friedensrelevanz von Kunst und Popkultur.
Mit Beiträgen u. a. von Dieter Segert, Claudia Brunner, Roy Casagranda, Werner Wintersteiner, Gerhard Senft und Mohssen Massarat.
Zur Vorstellung des Buches in Wien - link.


Grazer Forschungsbeiträge zu Frieden und Konflikt
Ist der Diskurs der Friedens- und Konfliktforschung bereits sehr weit, so ist das Feld der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Phänomenen Frieden und Konflikt noch viel breiter. Schließlich ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit Konflikt und Frieden über vielerlei wissenschaftlichen Disziplinen verbreitet, selbst wenn andere Begrifflichkeiten angewandt werden. Tatsächlich sehen sich wenige Forscher:innen in diesem Gegenstandsbereich innerhalb der Friedens- und Konfliktforschung verortet. Dadurch entstehen viele konzeptuelle und thematische Überscheidungen, die letztlich unbemerkt bleiben. Ein vermehrter Austausch zwischen genau jenen Diskursen wäre also nicht unerheblich als Fundament zukünftiger Synergien. Den Anfang einer solchen Grundlegung an der Universität Graz will dieser Sammelband machen und damit einen Beitrag zum Dialog zum wechselseitigen wissenschaftlichen Vorteil leisten. Dementsprechend verwundert auch das sehr breite Spektrum der disziplinären Verortung der Autor:innen dieses Sammelbandes nicht, die sich von den Rechtwissenschaften, den Geschichtswissenschaften und den Politikwissenschaften über die Soziologie, Philosophie und Kulturanthropologie bis hin zur Amerikanistik erstreckt.
Konfliktlandschaften des Südsudan: Fragmente eines Staates
Nach einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg erlangt die Republik Südsudan am 9. Juli 2011 ihre Unabhängigkeit. Doch trotz aller Bemühungen um einen friedlichen Staatsaufbau nimmt die erste Dekade der Eigenstaatlichkeit einen gewaltsamen Verlauf: Im Dezember 2013 schlittert der Südsudan in einen blutig geführten Bürgerkrieg, der sich nicht als einheitlicher Konflikt mit klar definierbaren Parteien, sondern zu einem Amalgam komplex verschachtelter Konfliktlandschaften entwickelt. In analytischen Vignetten, die verschiedene Regionen sowie die nationale und internationale Dimension des Bürgerkrieges untersuchen, gibt Jan Pospisil einen Einblick in die südsudanesische Konfliktrealität.


Augmented Democracy in der Politischen Bildung: Neue Herausforderungen der Digitalisierung
Der Band widmet sich dem Bereich Digitalisierung anhand unterschiedlicher Bezugspunkte zur Theorie und Praxis Politischer Bildung. Digitalisierung eröffnet den Bürger:innen einer demokratischen Gesellschaft neue Chancen für Partizipation und Informationsgewinn im eigenen Lebensbereich und bietet in diesem Kontext Potential für Demokratisieruns-prozesse. Digitalisierung bedeutet gleichzeitig neue Herausforderungen für den demokratischen Alltag und die Politische Bildung. Die Beiträge fragen kritisch, wie sich Digitalisierung auf die Politische Bildung auswirkt und ob sie konstruktiv zugunsten der gesellschaftlichen Demokratisierung genutzt werden kann.
Human and Minority Rights Protection by Multiple Diversity Governance: History, Law, Ideology and Politics in European Perspective
Human and Minority Rights Protection by Multiple Diversity Governance provides a comprehensive overview and critical analysis of minority protection through national constitutional law and international law in Europe. Using a critical theoretical and methodological approach, this textbook:
- provides a historical analysis of state formation and nation building in Europe with context of religious wars and political revolutions, including the (re-)conceptualisation of basic concepts and terms such as territoriality, sovereignty, state, nation and citizenship;
- deconstructs all primordial theories of ethnicity and provides a sociologically informed political theory for how to reconcile the functional prerequisites for political unity, legal equality and social cohesion with the preservation of cultural diversity;
- examines the liberal and nationalist ideological framing of minority protection in liberal-democratic regimes, including the case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice;
- analyses the ongoing trend of re-nationalisation in all parts of Europe and the number of legal instruments and mechanisms from voting rights to proportional representation in state bodies, forms of cultural and territorial autonomy and federalism.
This textbook will be essential reading for students, scholars and practitioners interested in European politics, human and minority rights, constitutional and international law, governance and nationalism.


Peace in Political Unsettlement: Beyond Solving Conflict
International peacebuilding has reached an impasse. Its lofty ambitions have resulted in at best middling success, punctuated by moments of outright failure. The discrediting of the term ‘liberal peacebuilding’ has seen it evolve to respond to the numerous critiques. Notions such as ‘inclusive peace’ merge the liberal paradigm with critical notions of context, and the need to refine practices to take account of ‘the local’ or ‘complexity’. However, how this would translate into clear guidance for the practice of peacebuilding is unclear. Paradoxically, contemporary peacebuilding policy has reached an unprecedented level of vagueness. Peace in political unsettlement provides an alternative response rooted in a new discourse, which aims to speak both to the experience of working in peace process settings. It maps a new understanding of peace processes as institutionalising formalised political unsettlement and points out new ways of engaging with it. The book points to the ways in which peace processes institutionalise forms of disagreement, creating ongoing processes to manage it, rather than resolve it. It suggests a modest approach of providing ‘hooks’ to future processes, maximising the use of creative non-solutions, and practices of disrelation, are discussed as pathways for pragmatic post-war transitions. It is only by understanding the nature and techniques of formalised political unsettlement that new constructive ways of engaging with it can be found.
»Arbeitsscheu und moralisch verkommen« Verfolgung von Frauen als »Asoziale« im Nationalsozialismus
Die nationalsozialistische Idee vom »reinen Volkskörper« kannte viele Ausschlusskriterien. In erster Linie waren sie rassistisch begründet und die »Volksgemeinschaft« daher exklusiv »arisch« konzipiert, in zweiter Linie galt es, die »schädlichen Elemente« innerhalb der eigenen Reihen zu entfernen. Darunter fielen auch Frauen, die aufgrund ihrer vermeintlich fehlenden Arbeitsmoral (»arbeitsscheu«) oder eines »amoralischen« Lebenswandels in den Fokus der Behörden gerieten. Dieses Verhalten wurde als »gemeinschaftsfremd« eingestuft und seine erbliche Veranlagung zu belegen versucht. Einweisungen in Arbeitsanstalten, Gefängnis- und KZ-Haft wie auch Zwangssterilisationen waren die Folgen. Beispiele aus den Gauen Wien und Niederdonau belegen zahlreiche dieser Frauenschicksale und das mit der Verfolgung verbundene behördliche Prozedere. Gerichtsverfahren und die Abwicklung von Entschädigungsanträgen zeigen, dass die Stigmatisierung von Frauen als »asozial« auch nach 1945 anhielt und auf vielen Ebenen nachteilige Folgen für Frauen hatte.


Friedensforschung, Konfliktforschung, Demokratieforschung: Ein Handbuch
Die neu erschienene Publikation des CPD-Clusters „Friedensforschung, Konfliktforschung, Demokratieforschung. Ein Handbuch" beleuchtet die drei genannten Forschungsfelder sowie ihre interdisziplinären Gemeinsamkeiten in Theorie, Konzept und Methodik.
Das Handbuch zur Friedens-, Konflikt- und Demokratieforschung ist das Ergebnis einer Kooperation von Forschungsinstituten, die im Conflict-Peace-Democracy-Cluster (CPDC) zusammengeschlossen sind. Es bietet Lehrenden, Studierenden und allen an politischer Bildung Interessierten Orientierung. Beiträge von Helga Amesberger, Blanka Bellak, Karin Bischof, Gertraud Diendorfer, Gert Dressel, Wolfgang Göderle, Wilfried Graf, Katharina Heimerl, Bernadette Knauder, Matthias Kopp, Maximilian Lakitsch, Karin Liebhart, Anton Pelinka, Susanne Reitmair-Juárez, Thomas Roithner, Dieter Segert, Karin Stögner, Johanna Urban und Werner Wintersteiner.
Website des Verlages.
Zivilgesellschaft im Konflikt: Vom Gelingen und Scheitern in Krisengebieten
In Syrien leistet die Zivilgesellschaft humanitäre Hilfe, wo es anderen Akteur:innen fast unmöglich ist; in Bosnien treiben NGOs den gesellschaftlichen Friedensprozess voran, wo staatliche und diplomatische Initiativen bereits lange gelähmt sind - weltweit leistet die Zivilgesellschaft unersetzbare Dienste bei der Konfliktbearbeitung. Doch oftmals übersteigt der Wunsch zu helfen auch die Fähigkeit dazu. So verändern und verlängern fehlendes Verständnis für lokale Bedürfnisse und nachhaltige Wirksamkeit manche Konflikte mitunter. Effektiver Einsatz im Dienste des Friedens verlangt gerade von zivilgesellschaftlichen Akteur:innen ein hohes Maß an Selbstreflexion.
In diesem Sinne versteht sich dieser Band zur 32. Sommerakademie an der Friedensburg Schlaining als ein kritischer und ermutigender Beitrag zum zivilgesellschaftlichen Engagement in internationalen Krisengebieten.
Website des Verlages.